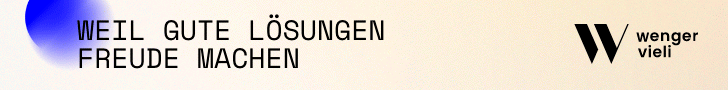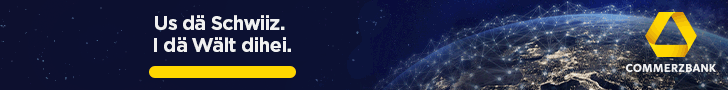Die Covid-Krise hat Unternehmen und Mitarbeitende besonders gefordert: wirtschaftlich, organisatorisch und gesundheitlich. Die Bedeutung eines wirksamen Gesundheitsmanagements nimmt zu. Insbesondere die psychische Gesundheit muss in den Unternehmen vermehrt zum Thema werden, sagt Stefan Büchi, Ärztlicher Direktor der Privatklinik Hohenegg. Eine Kultur der Offenheit, Transparenz und des Vertrauens ist unerlässlich. Sie stärkt die Resilienz der Mitarbeitenden und zahlt sich auch wirtschaftlich aus.

«Die Pandemie hat gezeigt: Wir müssen über psychische Gesundheit reden»
Interview mit Prof. Dr. med. Stefan Büchi, Ärztlicher Direktor der Privatklinik Hohenegg in Meilen bei Zürich
Die Folgen waren je nach Unternehmen unterschiedlich. Gewisse Branchen waren wenig betroffen, mussten allenfalls auf Homeoffice umstellen. Einige Branchen, zum Beispiel Kultur oder Gastronomie, durften von einem Tag auf den anderen nicht mehr arbeiten. Das führte bei vielen Menschen trotz Notfall-Krediten und Kurzarbeit zu existenziellen Ängsten und war mit viel Unsicherheit verbunden. Die sich laufend verändernden Massnahmen zwangen die Betriebe zudem, immer wieder umzustellen. Unternehmen und ihre Mitarbeitenden hatten eine hohe Anpassungsleistung zu erbringen, und es gab keine Planungssicherheit. Das zehrte an den Kräften. Zudem mussten in kurzer Abfolge einschneidende Entscheide gefällt werden. Das Krisenmanagement wurde auf die Probe gestellt.
Wir leiten die Klinik zu dritt: der Verwaltungsdirektor, die Pflegedirektorin und ich als Ärztlicher Direktor. Das war meines Erachtens vorteilhaft, weil wir Entscheidungen multiperspektivisch angehen konnten: unternehmerisch, pflegespezifisch bzw. hygienisch und medizinisch-therapeutisch. So fällten wir breit abgestützte Entscheidungen. In einem stark hierarchisch aufgestellten Betrieb, in dem eine Person allein über Entscheidungskompetenz verfügt, wäre das wohl schwieriger gewesen. Zudem können Entscheidungen, die nur auf einer Person lasten, in einem komplexen Umfeld zu Überforderung führen. Ich denke, Unternehmen, in denen Verantwortung breit abgestützt ist, kommen besser durch solche Krisen.
Ich denke schon. Und es braucht flache Hierarchien, das zeichnet moderne, erfolgreiche Unternehmen heute aus – und ist ja auch ein Trend in der Arbeitswelt 4.0. Gleichzeitig müssen Firmen in der Lage sein, schnell Entscheide zu fällen. Wichtig ist, dass diese von allen getragen werden.
Wer in stabilen Verhältnissen lebt, kommt mit Krisen wie einer Pandemie besser zurecht. Das System, in dem jemand lebt, und die Unterstützung durch das Umfeld sind bedeutsam. Während der Pandemie kamen Patientinnen und Patienten zu uns, die erschöpft waren durch eine Corona-bedingte Lebenssituation. Eindrücklich waren für mich beispielsweise alleinerziehende Mütter, die ihre Primarschulkinder im Homeschooling betreuen mussten, gleichzeitig eine neue Stelle antraten und einen Partner hatten, der sich bei der Kinderbetreuung als unzuverlässig erwies. In diesen Fällen hatten sich Belastungen kumuliert, welche die psychischen Widerstandskräfte überstiegen und über Schlafstörungen sowie Ängste zu einem psychischen Zusammenbruch führten.
Auf jeden Fall. Andere rückten durch die Krise zusammen. Covid stärkte die Bindungssicherheit. Generell gilt: Je nach psychischer Veranlagung kann Unsicherheit Angststörungen auslösen, einem gleichsam den Boden unter den Füssen wegziehen. Das hat sich während der Pandemie deutlich gezeigt. Wir sahen das zu Beginn der Krise auch bei unseren Mitarbeitenden; einzelne waren kaum arbeitsfähig. Später hat sich das beruhigt – wohl auch dank unserer Unternehmenskultur. Wir versuchen Sicherheit zu vermitteln, indem wir bei unseren Entscheiden transparent sind.
Wenn Unsicherheit chronisch wird, verbunden mit einem Gefühl der Isoliertheit, wie das bei monatelangem Homeoffice auftreten kann, ist das für die psychische Gesundheit problematisch. Lange hat man das während der Pandemie zu wenig wahrgenommen, mit der Zeit rückten psychische Erkrankungen zum Glück in den Fokus. Vor allem junge Menschen taten sich mit der Situation schwer. Es ist auffallend, dass viele Frauen und Männer zwischen 20 und 30 unsere Klinik aufsuchen. Das ist neu. Aber auch Jugendliche waren von der Krise besonders betroffen.
Die ganze Freizeit- und Jugendkultur war eine Zeit lang eingestellt. Kaum Sport, keine Treffen in Gruppen. Das fehlte den Jungen und schadete ihrer psychischen Gesundheit. Man konnte das nicht einfach digital ersetzen. Hinzu kam die Sorge um die berufliche Zukunft: Wie viel Wert wird mein «Corona»-Berufsabschluss, mein «Corona»-Maturitätszeugnis sein? Das Wohlbefinden von Jugendlichen hat sich aber schon vor der Pandemie verschlechtert. Eine Longitudinalstudie aus England hat gezeigt, dass sich die psychische Gesundheit junger Menschen von 2005 bis 2015 markant verschlechtert hat: Depressionen und Angstzustände haben zugenommen. Die Digitalisierung hat wohl zu diesem Ergebnis beigetragen. 25 Prozent der Jugendlichen wiesen schon vor der Pandemie einen eigentlichen Smartphone-Abusus auf. Dieser hat sich während der Krise mit Sicherheit verstärkt. Besonders besorgniserregend ist: Suizidgedanken von Jugendlichen haben in der westlichen Welt epidemisch zugenommen. Wir sehen das auch bei uns – die jugendpsychiatrischen Abteilungen sind in der Schweiz sehr ausgelastet.
Viele Menschen sind mit Homeoffice gut zurechtgekommen. Sie genossen die Freiheit und schätzten das überaus konzentrierte Arbeiten, weil sie zuhause weniger abgelenkt waren als im Büro. Aber es gibt eben auch eine beträchtliche Anzahl von Mitarbeitenden, denen zu viel Homeoffice schadet, die krank werden, was Unternehmen im Übrigen teuer zu stehen kommt. Diese Menschen fühlen sich isoliert. Wir dürfen den sozialen Aspekt von Arbeit, die alltägliche Interaktion im Betrieb nicht unterschätzen. Ich rate davon ab, Homeoffice zu übertreiben, ein Mix von remote work und Arbeiten im Büro ist sinnvoll. Dies wünschen sich ja auch viele Angestellte, wie Umfragen gezeigt haben. Die meisten Menschen brauchen die Kommunikation im Team sowie Alltagsrituale wie das Pendeln, das gemeinsame Mittagessen oder das Feierabendbier.
Studien haben gezeigt: Der wichtigste psychiatrisch protektive Faktor im Unternehmen ist ein verständnisvoller Vorgesetzter. Er oder sie sollte Verständnis haben für die psychische Befindlichkeit der Mitarbeitenden. Deshalb ist es wichtig, dass Unternehmen entsprechende Kompetenzen entwickeln. Eine Chefin oder ein Chef muss verstehen, dass psychische Probleme relativ unvermittelt auftauchen können, und wissen, wie damit umgehen. Dass auch Vorgesetzte von psychischen Krisen betroffen und überfordert sind, ist hilfreich. Solche Erfahrungen stärken das Verständnis. Unternehmen arbeiten sinnvollerweise mit Fachleuten zusammen, die sie im Umgang mit psychischen Problemen von Mitarbeitenden unterstützen. Die psychische Gesundheit muss Thema sein. Sinnvoll ist auch, Raum für gemeinsames Erleben, soziale Interaktion zu schaffen: Anlässe, Ausflüge, Austauschmöglichkeiten. Es geht darum, die Zusammengehörigkeit unter den Mitarbeitenden zu stärken, denn gute Beziehungen tragen zur Resilienz bei.
Weniger als früher, weil die meisten Menschen mindestens einmal in ihrem Leben mit psychischen Schwierigkeiten konfrontiert sind und sich die Haltung gegenüber psychischen Krankheiten verändert hat. Die Gesellschaft ist offener geworden. Dennoch ist es für viele verständlicherweise schwierig, über ihre Probleme zu sprechen, auch weil sie das nicht gelernt haben. Es fehlt ihnen die Sprache dazu. Daher wären Schulungen wichtig, in denen man lernt, wie man über die eigene Befindlichkeit redet und, andererseits, wie man Menschen mit psychischen Problemen anspricht. Initiativen wie die «Erste-Hilfe-Kurse für psychische Gesundheit» von Pro Mente Sana sind da bestimmt hilfreich und sinnvoll. Diese Kurse entsprechen offenbar auch einem Bedürfnis, wie die hohen Absolventenzahlen zeigen. Arbeitgeber sind meines Erachtens auf jeden Fall in der Pflicht – auch wenn man als Arbeitgeber bei persönlichen Belangen und allzu Privatem gerne Zurückhaltung übt –, die psychische Gesundheit der Mitarbeitenden prioritär auf die Agenda zu setzen.
Die Wahrnehmung der eigenen Befindlichkeit und die Fähigkeit, diese Wahrnehmung zu verbalisieren, ist zentral für die psychische Gesundheit und trägt zur Prävention bei. Diese Art von Achtsamkeit und Kommunikation wird in unserer Gesellschaft und in der Schule leider viel zu wenig eingeübt. Vorurteile und Tabuisierung verstellen nach wie vor den Blick auf die psychische Befindlichkeit. Zudem würde das Reden der bisweilen fatalen Einsamkeit der Menschen entgegenwirken. Einsamkeit gehört zu den relevantesten negativen Faktoren, die Gesundheit beeinflussen. Sie hat einen grösseren Impact als Rauchen, Alkohol oder Diabetes. Man muss die Menschen zusammenbringen, denn Beziehung und Austausch sind gesund und stärken das Immunsystem. Es war erstaunlich, dass dies, wenn wir uns die Covid-Massnahmen und unseren Umgang mit der Pandemie vor Augen halten, so wenig thematisiert wurde.
Unbedingt. In der Privatklinik Hohenegg arbeiten wir bei suizidgefährdeten Menschen mit dem Tool PRISM-S, einem Tool, mit dem ein Arzt, eine Ärztin gemeinsam mit dem Betroffenen Lebenssituationen bildlich und einfach veranschaulichen kann. Dadurch erkennen wir eine mögliche Suizid-Gefährdung. Die Arbeit mit PRISM-S erleichtert die Kommunikation über Suizidgedanken, zeigt im therapeutischen Verlauf Entwicklungen auf und schafft ein gemeinsames Verständnis. Ich habe PRISM vor langer Zeit gemeinsam mit Prof. Tom Sensky vom Imperial College in London entwickelt, arbeite seit vielen Jahren damit, und wir haben es in der Hohenegg in Zusammenarbeit mit Gregor Harbauer und Sebastian Haas für die Suizidprävention adaptiert. Nun setzen wir von der Privatklinik Hohenegg das Werkzeug im Rahmen von «SERO», einem von Gesundheitsförderung Schweiz mit 1.5 Millionen Franken unterstützten Projekt zur Suizidprävention, im Kanton Luzern ein.
Long Covid ist eine komplexe und unberechenbare Krankheit; vieles ist noch unerforscht. Sie betrifft Körper und Psyche, die Symptome sind mannigfaltig und verunsichern Betroffene: Müdigkeit, Antriebslosigkeit, Ängste, Schwindel, Konzentrationsschwierigkeiten. Ganz wichtig für die Kranken ist hier das Vertrauen des Vorgesetzten. Ein Betroffener muss spüren, dass man ihm glaubt. Denn die Symptome sind für andere ja unsichtbar. Die Beeinträchtigungen sind da, aber sie sind kaum objektivierbar. Vertrauen unterstützt Betroffene bei der Genesung. Arbeitgeber und Arbeitnehmer sollten gemeinsam besprechen, welche Aufgaben der Angeschlagene im Moment zu bewältigen vermag, welche Aufgaben er wie schnell erfüllen kann. Man spricht von Pacing. Auch hier ist das Gespräch wichtig: «Was traust du dir zu? Was ist möglich? Was nicht?» Überforderung ist schädlich, eine totale Krankschreibung wenig hilfreich.
Long Covid ist für Betroffene und Teams anspruchsvoll. Ein Betroffener erkennt, dass er nicht mehr gleich viel zu leisten vermag, hat möglicherweise gegenüber Kolleginnen und Kollegen ein schlechtes Gewissen und setzt sich unter Druck. Teams wiederum wissen nicht, wie es dem Mitarbeitenden wirklich geht. Auch hier hilft nur: eine Kultur des Vertrauens und darüber reden. Ein Long-Covid-Kranker sollte genau schildern, wie es ihm geht, seine Sorgen und Bedenken aussprechen. Die Teammitglieder wiederum müssen Verständnis zeigen, alle müssen flexibler sein bei der Übernahme von Aufgaben, und es braucht mehr Feinabstimmung. Es ist offensichtlich, dass hier Teamgeist und Kultur entscheidend sind.
Interview: Rolf Murbach
Das als Long Covid beschriebene Krankheitsbild besteht aus vielfältigen Symptomen, die sich über mehrere Monate nach einer Covid-19-Infektion hinziehen können. Betroffene leiden unter anderem an neuropsychiatrischen Folgen wie Depressionen, Angsterkrankungen, Schlafstörungen, Geruchsverlust und Fatigue. Die Ursachen sind weiterhin unklar, eine einheitliche Definition besteht nicht, zudem gibt es keine klaren therapeutischen Richtlinien.
Die Klinik Hohenegg versucht, den Betroffenen, die an Long-Covid-Symptomen leiden, ein therapeutisches und diagnostisches Angebot zu bieten. Das Ziel besteht vor allem darin, einen Umgang mit den Krankheitssymptomen, eine seelische Stabilisierung sowie die Rückkehr in den Alltag zu ermöglichen.
Dieses Pilotprojekt in der Region Luzern setzt vier zentrale Massnahmen zur Suizidprävention um: PRISM-S Methode, Sicherheitsplan, ensa – Kurs für Angehörige sowie Selbstmanagement-App. Diese Massnahmen optimieren das Selbstmanagement bei Suizidgefährdung, erhöhen die Selbstwirksamkeit suizidgefährdeter Menschen sowie ihrer Angehörigen und fördern die koordinierte und vernetzte Versorgung durch Professionelle in der Region.
ist ein gemeinsames Programm der Stiftung Pro Mente Sana und der Beisheim Stiftung – unter Lizenz von Mental Health First Aid (MHFA), Melbourne.
Der ensa-Erste-Hilfe-Kurs soll Laien – Verwandte, Freunde, Bekannte, Arbeitskolleg*innen – befähigen, nahestehende Personen mit psychischen Schwierigkeiten zu unterstützen und Erste-Hilfe-Massnahmen anzuwenden.