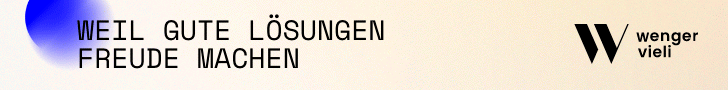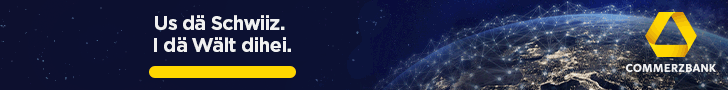1. Die EU sieht sich mit grossen Herausforderungen konfrontiert: Erst die Staatsschuldenkrise, nun die Flüchtlingskrise. Dabei vermittelt sie den Eindruck wachsender Differenzen der Staaten untereinander. Sind hier stärker werdende Erosionskräfte am Werk?
FISCHER: In der Tat stellen die Ereignisse spätestens seit dem letzten Jahr die EU vor grosse Herausforderungen. Russland ist zu einer neo-imperialen Grossmachtpolitik zurückgekehrt und führt Krieg im Osten der Ukraine. Der Nahe Osten zerfällt und Syrien leidet unter einem nicht enden wollenden Bürgerkrieg, an dessen Ende mit grosser Wahrscheinlichkeit die Teilung des heutigen Staatsgebietes stehen wird. Und das hat Auswirkungen nicht nur auf Syrien, sondern auch auf alle angrenzen Länder – wie zum Beispiel den Irak. Die Folgen dieses Staatenzerfalls erleben wir nun tagtäglich vor der sprichwörtlich eigenen Haustür.
Täglich verlassen tausende Flüchtlinge ihre Heimat oder die Flüchtlingscamps im Libanon oder der Türkei, um Schutz und ein menschenwürdiges Leben in Europa zu suchen. Damit steht schon heute fest: Europa und die EU werden sich in der Zusammensetzung ihrer Bevölkerung verändern. Das ist ein Fakt. Zudem hat die Eurozone die langjährige Wirtschafts- und Finanzkrise noch immer nicht ausgestanden.
Beide Krisen – die Finanz- wie die aussenpolitische Krise – zeigen, dass es im europäischen Einigungsprojekt fundamentale innere Fehler gibt. Und damit steht Europa aktuell wieder vor der uralten Frage nach seiner Verfasstheit. Nach der Frage: lose Konföderation oder echte Föderation? Das ist der Kern der Frage, um die sich alles in Europa dreht. Dass bei einer solchen Frage Flieh- und Erosionskräfte am Werk sind, liegt in der Natur der Sache. Aber, wir müssen uns dieser Frage nun endlich mit all ihren Konsequenzen stellen. Und da vermisse ich persönlich schon länger den politischen Gestaltungswillen der handelnden Akteure.
2. Wo sehen Sie die Ansatzpunkte für eine nachhaltige Weiterentwicklung der Europäischen Union?
FISCHER: Europa hat sich immer in Zeiten der Krisen bewegt und verändert. Reformen in Zeiten von Stabilität, Wohlstand und Prosperität sind selten bis nicht existent. Es scheint, als ob wir besonders starke Herausforderungen brauchen, um zu erkennen, dass es Zeit für eine Anpassung beziehungsweise Weiterentwicklung ist. Insofern stehen wir aktuell vor vielen «Ansatzpunkten».
Wir dürfen uns aber nicht in Kleinstaaterei verlieren, sondern müssen uns im Kern einig sein, dass wir den aktuellen Krisen – so elementar und langfristig diese sind – nur gemeinsam in einer entscheidungsfähigen und damit föderal angepassten Struktur begegnen können. Von lösen will ich schon gar nicht sprechen.
Den Herausforderungen der internationalen Krisenherde, des Terrorismus, die Folgen des Klimawandels und auch der Verschiebung der internationalen Machtzentren Richtung Ostasien können wir uns nur europäisch stellen – wenn wir Europäer auch in Zukunft über unser eigenes Schicksal bestimmen wollen. Oder denken sie an die Folgen der Digitalisierung. Anhand der immer neuen Routen der Flüchtlinge – die per Smartphone in «real time» sehen können, welche Wege sie gehen müssen – ist diese beeindruckend zu beobachten. So viele Mauern und Grenzen können sie gar nicht ziehen! Abgesehen davon, dass dies die Menschlichkeit und die Erinnerung an die eigene europäische Geschichte verbietet.
Es mangelt also nicht an «Ansatzpunkten». Entscheidend ist, diese als ein Gesamtgefüge zu sehen, dass uns Europäer dazu bringt zu realisieren, dass nur ein starkes Europa eine Zukunft hat. Da beziehe ich die Schweiz übrigens mit ein. Auf Dauer in der Mitte Europas zwar von der EU zu profitieren, aber stets auf den eigenen nationalen Nutzen zu achten, wird auch für die Schweiz zunehmend schwierig werden. Denn da machen wir uns bitte nichts vor: Scheitert die EU, dann scheitert auch Europa!
3. In welche Richtung könnte die EU sich entwickeln? Die Vereinigten Staaten von Europa mit föderaler Präsidialverfassung: Ist dieses amerikanische Modell auf die EU übertragbar?
FISCHER: Die EU hängt gewissermassen zwischen Baum und Borke: Sie ist kein gemeinsamer Staat, wird aber von der meisten ihrer Bürger als eine Art Superstaat angesehen. Besonders im Süden zeigt sich das in der Zuweisung der Verantwortung für die Finanzkrise und in dem Vorwurf des Verlustes demokratischer Kontrolle. Aber der föderale Traum Europas mit dem Vorbild USA kann nicht funktionieren.
Die EU hat heute 28 Mitgliedsstaaten in denen 500 Millionen Menschen leben, die alle unterschiedliche Sprachen sprechen. Die Nationen der EU berufen sich auf jahrtausendealte Traditionen und sehr eigene Identitäten. Im Zuge der Griechenlandkrise konnte man verfolgen, wie entscheidend unterschiedliche Historien und auch ihre jeweiligen nationalen Deutungen sind. Können sie sich einen europäischen Wahlkampf mit Kandidaten für einen direkt gewählten Präsidenten vorstellen, den weite Teile der Wählerschaft nicht direkt verstehen, da er ihre Sprache nicht spricht? Ich nicht! Ich denke da eher an ein europäisches Vorbild – ich denke an die Schweiz. Denn auch die Schweiz besteht aus unterschiedlichen ethnischen Gruppen und diese Gruppen haben sich bis heute nicht homogenisiert.
Wenn wir zurückblicken, dann stellte sich nach den Wirrungen der Kriege des 19. Jahrhunderts für die nur lose verbundenen Kantone in ihrer konföderativen Verfassung ja auch die Existenzfrage. Wenn sich die innerschweizerischen Kantone im Sonderbundeskrieg durchgesetzt hätten, wäre die Schweiz als eigenständiger Staat in den Zeiten des europäischen Nationalismus in ihre nationalen Bestandteile zerfallen. Nur der «Vernunftsstaat» Schweiz konnte sich den Nationalismen entziehen und er wurde ein modernes Europa im Kleinen. Mit der direkten Demokratie und einer politischen, sprachlichen und ethnischen Heterogenität. Damit passt die Schweiz in der Tat als funktionierendes «föderales» Modell für die Europäische Union.
4. Wäre die klare Kompetenzverteilung zwischen EU Kommission und den Mitgliedsstaaten der Schlüssel die politische Union zu vertiefen? Oder muss das Zusammenspiel zwischen Kommission, EU Parlament und den Organen der Mitgliedsstaaten neu überdacht werden?
FISCHER: Wenn wir uns die Strukturen der heutigen EU anschauen, dann scheint mir der Schlüssel hin zu weiteren Reformen in den Händen der Eurogruppe zu liegen. Alle Verschiebungen der Kompetenzen im bestehenden Gefüge kosten viel Kraft und Zeit – und greifen schlussendlich zu kurz.
Aus meiner Sicht sollten die Staaten der Eurogruppe in einem ersten Schritt eine Regierung der Eurozone bilden. Ich denke da an eine Eurokammer – analog dem Schweizer Vorbild –, die sich proportional zusammensetzt. Das löst die Frage nach der Direktwahl, die sich absehbar nicht realisieren lässt. Diese Kammer wäre zuständig für alle Haushalts-, Finanz- und Wirtschaftsfragen und entscheidet in allen Fragen der Subsidiarität – also der Machtverteilung zwischen den Mitgliedsstaaten sowie der Union und in europäischen Verfassungsfragen. So könnte eine neue europäische und auch demokratische Wirklichkeit entstehen, die die gesamte EU im Laufe der Zeit in diese Richtung transformieren würde.
5. In der Schweiz wird die EU – zu Recht oder zu Unrecht – als zentralisierend und nicht basis-demokratisch dargestellt. Können Sie das anhand der Fakten nachvollziehen oder ist diese Wahrnehmung verzerrt?
FISCHER: Das wird leider nicht nur in der Schweiz so gesehen, sondern auch innerhalb der EU. «Basisdemokratisch» allerdings sind jenseits der Schweiz auch die nationalen Verfassungen der EU Mitgliedstaaten nicht. Das ist das ewige Lied von den graden Bananen und Energiesparglühbirnen aus Brüssel.
Aus meiner eigenen Erfahrung als ehemaliger Bundespolitiker der Grünen, für die ich lange im Bundesland Hessen – auch in Regierungsverantwortung – aktiv war, weiss ich: Der Verweis auf die vermeintlich nächsthöhere politische Ebene, aus der immer nur der Fluch und nie der Segen kommt, ist ein altes politisches Lied. Und es gibt natürlich in ganz Europa – auch in Deutschland – politische Kräfte durch deren Wahlprogramme sich eine europäische Schuldzuweisung zieht. In dieser Liga ist leider auch die Schweiz vertreten.
Die Lösung liegt doch darin, sich endlich auf den Weg zu machen, die europäische Idee nicht auf die gemeinsame Wirtschaftskraft zu reduzieren – sondern auf allen Ebenen zu verdeutlichen, dass der europäische Nationalstaat in dieser zunehmend globalisierten und sich rasant digitalisierten Welt mit einem nicht aufzuhaltenden Klimawandel kein Zukunftsmodell mehr ist. Die wichtige und identitätsstiftende Rolle der Länder, Kommunen, Städte und Gemeinden wird damit doch nicht in Frage gestellt!
Denken sie doch mal, welche entscheiden Rolle die Bürgermeister der Grossstädte und Megacities der Welt haben, die alle Prozesse anstossen müssen, um die stetig wachsende Stadtbevölkerung in die nötigen Anpassungen der Urbanisierung einzubinden und mitzunehmen. Ohne demokratische Prozesse – und damit einer Partizipation der Bürger – geht das nicht.
Natürlich sollte man sich als überzeugter Demokrat immer auch die Frage nach mehr direkter Demokratie stellen. Ich habe es im Kontext der Schweiz als Vorbild für eine europäische Verfasstheit ja umschrieben. Plebiszitäre Elemente werden hier sicher eine wichtige Rolle spielen. Aber ich warne davor, immer alles Schlechte in Brüssel zu sehen. Da machen es sich die Leute zu einfach. Was glauben sie denn, warum so viele Flüchtlinge nach Europa kommen? Doch auch wegen der stabilen rechtsstaatlichen Strukturen, die dieses Europa hat. Hinzu kommt, dass viele nationale Entscheidungsprozesse gezielt nach Europa verlagert werden, denn dann muss man sich politisch im eigenen Lande nicht klar positionieren. Wie oft hören wir, dass eine europäische Lösung gebraucht wird, obwohl es durchaus nationale Entscheidungsbefugnisse gäbe. Übrigens ein beliebtes Argument, um schärfere Umweltstandards zu vermeiden.
6. Von vielen wird eine stärkere Führungsrolle Deutschlands bei den aktuellen Krisen in Europa erwartet; für viele andere wäre diese Rolle eher bedrohlich. Welchen Weg muss die deutsche Politik nach Ihrer Einschätzung in Zukunft einschlagen?
FISCHER: Deutschland muss seine Führungsrolle in Europa annehmen. Wir sind das wirtschaftsstärkste und bevölkerungsreichste Land. Und wir waren bislang die grossen Profiteure des einigen Europas – gerade wirtschaftlich. Das Führen und Deutschland bei vielen einen unangenehmen Beiklang hat, kann ich verstehen. Dem muss deutsche Aussenpolitik immer Rechnung tragen. Am Ende ist nichts wertvoller für ein friedliches und einvernehmliches Zusammenleben in Europa als eine starke und einige EU.
(Bildquelle: © EdStock/iStockphoto)